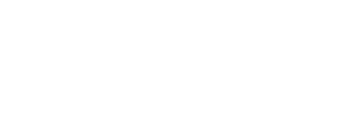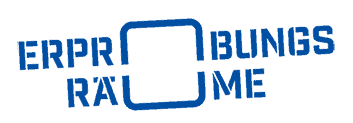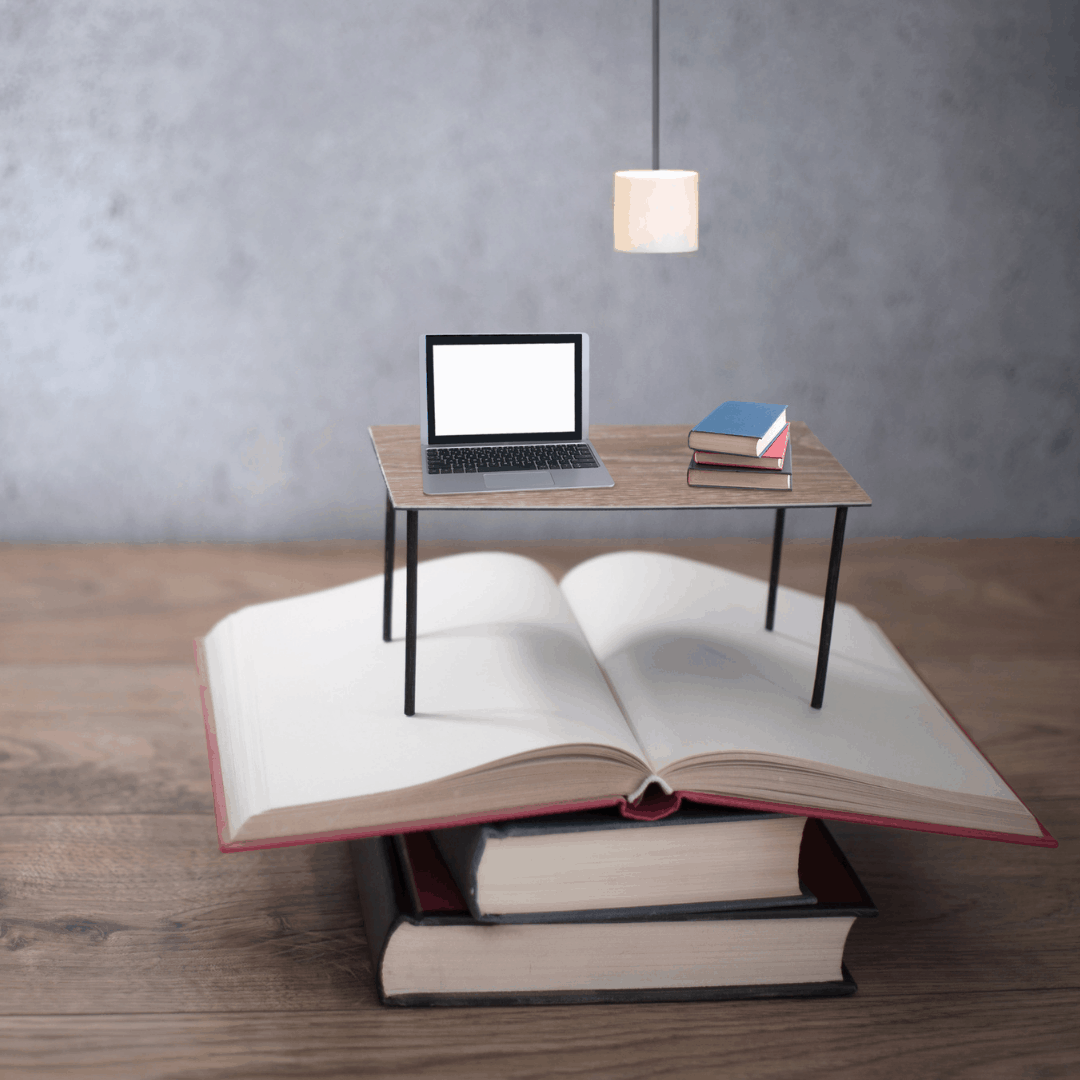Studientag Erprobungsräume 11. September 2020
Thesen und Fragen zu den Erprobungsräumen der EKM
Die derzeit vorhandenen und geförderten Erprobungsräume stiften produktive Unruhe – in benach-barten Kirchengemeinden, aber auch im Gesamtsystem der EKM. Die Frage: „Wie verändern die Er-probungsräume die EKM insgesamt?“ macht den gedanklichen Dreh- und Angelpunkt der nachfol-genden Überlegungen aus.
Thesen zum bisherigen Verlauf des Programmes Erprobungsräume:
- Immer mehr Kirchengemeinden stellen sich der Notwendigkeit, neue Wege zu beschreiten. Dabei zeigt sich, dass die sieben für die Erprobungsräume formulierten Kriterien auch „klassische“ Kir-chengemeinden inspirieren können (Gemeinde entsteht neu; Logik von Parochie, Hauptamt und Kirchengebäude wird überschritten; bislang Unerreichte erreichen; sich auf den Kontext einlas-sen; Rolle der Freiwilligkeit; alternative Finanzquellen; gelebte Spiritualität). In den sieben Krite-rien werden Merkmale einer aufgeschlossenen Kirche formuliert, die über die Erprobungsräume hinaus verallgemeinerungsfähig sind. Das spricht für den theologischen Gehalt der Kriterien und für das ihnen innewohnende transformative Potential.
- Es wäre konzeptionell zu kurz gesprungen, Erprobung nur auf „neue“ Gemeindeformen zu be-schränken. Auch in bestehenden Kirchengemeinden ist innovatives Potential vorhanden, das wahrgenommen werden will und gefördert zu werden verdient.
- Je breiter angelegt „Erprobung“ in der EKM stattfindet, umso wichtiger ist es, auch weiterhin klar zu definieren, was Erprobung ausmacht und was nicht. Unterbleibt das, verliert der Begriff „Er-probung“ seine unterscheidende Kraft und wird zur Leerformel. Wenn ein Zustand entsteht, in dem alles irgendwie Erprobung ist, dann liegt der Verdacht nahe, dass der ursprüngliche Verän-derungsimpuls erfolgreich vom Status quo aufgesogen wurde.
- Das Programm Erprobungsräume hat mittlerweile weit über die EKM hinaus eine positive Aus-strahlungswirkung entfaltet. Die EKM wird in der kirchlichen Öffentlichkeit als innovativ und mu-tig wahrgenommen. Sich von diesem Image in die Pflicht nehmen zu lassen, ist Bürde und Chance zugleich.
- Jede Organisation hat ihren spezifischen Lebenszyklus. Das gilt auch für die unterschiedlichen Formen von Kirchengemeinden. Die Dauerhaftigkeit von evangelischer Kirche steht nicht im Wi-derspruch dazu, dass ihre einzelnen Gemeinden vergängliche Gebilde in Zeit und Raum sind.
- Erprobung ist mehr als die Schaffung innovativer Inseln in einer ansonsten unverändert bleiben-den Kirche. Es geht um eine allmähliche Transformation der EKM als Ganzes: zu einer Kirche, die das Neben- und Miteinander unterschiedlicher Formen von Gemeinde ermöglicht. Dieses Fern-ziel muss jedoch von den kirchenleitenden Gremien gewollt sein – mit all den Spannungen und Konflikten, die damit verbunden sind.
Fragen, die sich mit Blick auf die Zukunft der Erprobungsräume stellen:
- Die Landeskirche bietet den Erprobungsräumen fachliche Begleitung, juristische Beratung und finanzielle Unterstützung an. Werden diese drei Angebote von den Antragstellerinnen und An-tragstellern in gleichem Maße nachgefragt? Welche Schlussfolgerungen lassen sich aus der Sym-metrie oder Asymmetrie des Nachfrageverhaltens für die zukünftige Form der landeskirchlichen Unterstützung und Begleitung der Erprobungsräume ziehen?
- Welche Kriterien muss ein Erprobungsraum erfüllen, um „nachhaltig“ zu sein? Wie viele Erpro-bungsräume können in diesem Sinne derzeit als nachhaltig bezeichnet werden? Gibt es Erpro-bungsräume, denen es gelungen ist, sich für einen längeren Zeitraum alternative Finanzquellen zu erschließen?
- Artikel 3, Absatz 2 der Verfassung der EKM sieht die Rolle von besonderen Formen von Ge-meinde darin, dass sie das Leben der kirchlichen Körperschaften nach Maßgabe der kirchlichen Ordnung ergänzen. Inwieweit ist dieser zukunftsweisende Anspruch der Kirchenverfassung im Recht der EKM konkret eingelöst, indem in Kirchengesetzen, Verordnungen, Satzungen etc. inhaltlich darauf Bezug genommen wird?
- Wo gibt es Reibungspunkte und Konflikte zwischen Erprobungsräumen (als neuen Formen von Gemeinde) und vorhandenen kirchlichen Strukturen und Ordnungen? Auf welche Herausforde-rungen und Handlungsbedarfe weisen diese Reibungspunkte und Konflikte hin?
- Was ist zu tun, damit aus dem geförderten Ausnahmetatbestand, den die Erprobungsräume der-zeit darstellen, ein ganz normaler Bestandteil des kirchlichen Lebens in der EKM wird?
- Wie kann perspektivisch das Nebeneinander von neuen und „klassischen“ Gemeindeformen in ein produktives Miteinander verwandelt werden? Welche Anreize sind denkbar, um Kooperation und Zusammenarbeit zwischen unterschiedlichen Formen von Gemeinden zu fördern? Welche Hindernisse (auch mentaler Art) müssen dafür überwunden werden?
Erfurt, den 10.08.2020 Dr. Jürgen Gimmel Leiter Referat A2